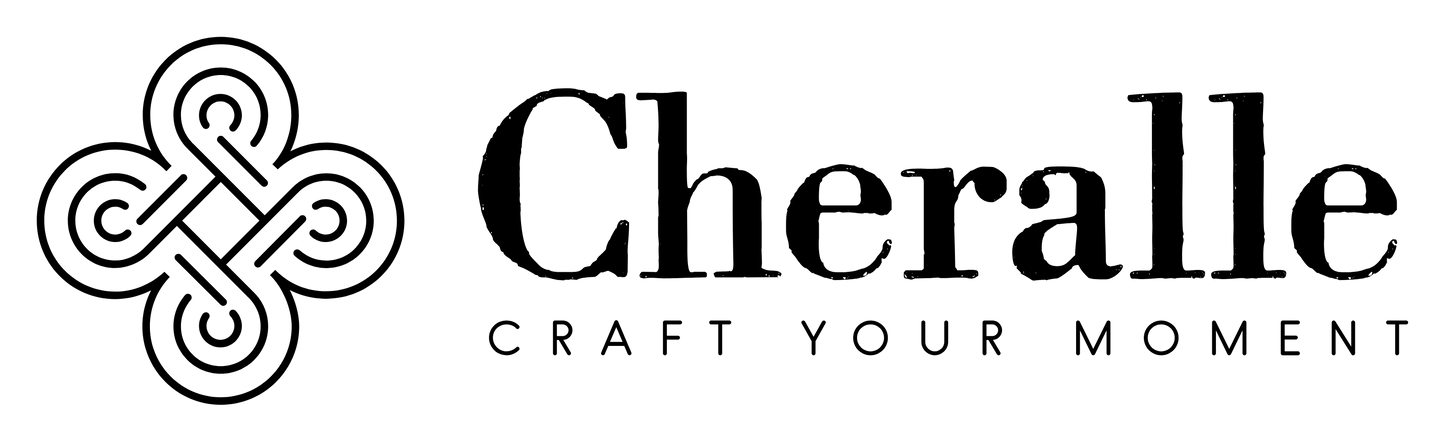Für alle, die sich für Keramik begeistern, ist Kaolin ein bekannter Begriff. Wer jedoch noch nie in der Keramikindustrie tätig war, wird damit möglicherweise nicht vertraut sein. Selbst eine Google-Suche liefert nur begrenzte Informationen über Kaolin. Dieses unauffällige Material spielt seit über tausend Jahren eine entscheidende Rolle in der Geschichte und Entwicklung der Keramikindustrie.
Kaolin verdankt seinen Namen dem Dorf Gaoling, 50 Kilometer von Jingdezhen, der Welthauptstadt des Porzellans, entfernt. Der Begriff leitet sich von der chinesischen Aussprache des Dorfes Gaoling ab. Die Entdeckung von Kaolin liegt etwa 800 Jahre zurück, während der Blütezeit der Jingdezhen-Keramik in der Südlichen Song-Dynastie. Damals verwendeten Keramikhandwerker hauptsächlich Porzellanstein, der 15–18 % Aluminiumoxid enthält und bei 1200 °C gebrannt werden muss. Obwohl er den Vorteil einer dichten Masse hat, sind seine Nachteile geringe Feuerfestigkeit, geringe Festigkeit und Verformungsanfälligkeit.

Mit dem florierenden Keramikhandel stieg auch die Nachfrage nach Rohstoffen, was zur Verknappung der Porzellansteinvorräte führte. Handwerker entdeckten dieses neue Keramikmaterial am Gaoling-Berg. Dieser Ton ist hochfeuerfest und fest, hat einen Aluminiumoxidgehalt von 33–40 % und erfordert eine Brenntemperatur von 1.200–1.400 °C. Mit nur 0,6 % Eisengehalt erreicht das gebrannte Produkt eine Weiße von über 82 %. Durch die Mischung mit Porzellanstein in einem bestimmten Verhältnis verbesserte sich der Aluminiumoxid- und Mullitgehalt im Porzellankörper, wodurch die Mikrostruktur des Porzellans verbessert, seine Härte und thermische Stabilität erhöht und die Wahrscheinlichkeit von Verformungen beim Brennen deutlich reduziert wurde, was wiederum die Ausbeute enorm verbesserte. Man sagt, „Kaolin ist das Skelett des Porzellans, während Porzellanerde sein Fleisch ist.“
Die Einführung von Kaolin ermöglichte die Verwirklichung des Traums von der Herstellung großer Keramikarbeiten wie Vasen und Aquarien. Die Entdeckung von Kaolin löste somit nicht nur die damalige Rohstoffkrise, sondern trieb auch die revolutionäre Entwicklung der Porzellanindustrie Jingdezhens maßgeblich voran und etablierte die Stadt als eine renommierte Welthauptstadt des Porzellans.
In den Jahren 1712 und 1717 berichtete der französische Missionar François Xavier d'Entrecolles der französischen Regierung über den Abbauprozess, die Herstellungstechniken und die Technologien zur Porzellanherstellung und schickte sogar Kaolinproben nach Frankreich, was zur Entwicklung der Keramik in Europa beitrug.


1896 machte der deutsche Geologe Ferdinand von Richthofen es international bekannt und nannte es „Kaolin“. Kaolin ist das erste nichtmetallische Mineral, dessen Name sich von seinem Ursprungsort in China ableitet. Zu seinen Hauptbestandteilen zählen Kaolinit, Halloysit, Muskovit, Illit und Montmorillonit sowie Mineralien wie Quarz und Feldspat. Kaolin wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter in der Keramik-, Papier-, Beschichtungs-, Gummi-, Chemie-, Pharma- und Rüstungsindustrie, und besitzt einen erheblichen wirtschaftlichen und kulturellen Wert. In Jingdezhen beschreibt man Porzellan auf Kaolinbasis als „weiß wie Jade, hell wie ein Spiegel, dünn wie Papier und klangvoll wie ein Glockenspiel“.

Kaolin kommt in zwei Formen vor: verwittert und ausgelaugt. Verwitterter Kaolin befindet sich nahe der Oberfläche und kann direkt abgebaut werden, während ausgelaugter Kaolin, der durch natürliches Auswaschen von Wasser entsteht, in Felsspalten fließt und unterirdisch abgebaut werden muss.
Produktionsprozess:
- Zerkleinern und Mahlen: Das Kaolin wird zunächst zerkleinert, um große Partikel und Verunreinigungen zu entfernen, und dann zu einem feinen Pulver gemahlen, um die Oberfläche und Plastizität zu erhöhen.
- Klassifizierung und Waschen: Das Kaolin wird gesiebt und gewaschen, um Verunreinigungen und minderwertige Partikel zu entfernen und so die Reinheit zu verbessern.
- Trocknen und Verpacken: Der gereinigte Kaolin wird getrocknet, um den Feuchtigkeitsgehalt zu reduzieren, und dann für den Versand an Keramikfabriken verpackt.
Vergleich von Kaolin mit anderen keramischen Tonen:
- Hervorragende Plastizität: Kaolin verfügt über eine gute Plastizität, wodurch es leicht zu formen ist und sich für die Herstellung komplexer Keramikformen eignet.
- Hohe Feuerfestigkeit: Kaolin hält hohen Brenntemperaturen von 1300 °C bis 1400 °C stand und ist daher ideal für feuerfeste Keramik und hochwertiges Porzellan.
- Überragende Weiße und Transparenz: Mit einem Eisengehalt von nur 0,6 % gewährleistet Kaolin maßgeblich die Weiße und Reinheit von Porzellan, was für die Produktion von High-End-Produkten entscheidend ist.
- Geringere Schrumpfungsrate: Kaolin weist beim Trocknen und Brennen eine geringe Schrumpfungsrate auf, wodurch das Risiko von Verformungen und Rissen verringert und das Endprodukt stabilisiert wird.
- Gute chemische Stabilität: Kaolin ist chemisch stabil und beständig gegen Säure- und Alkalikorrosion, sodass es sich für Laborgeschirr und andere Keramiken eignet, die chemische Beständigkeit erfordern.
- Geringe Wasseraufnahme: Die geringe Wasseraufnahme von Kaolin bedeutet, dass die daraus resultierenden Keramikprodukte weniger Feuchtigkeit aufnehmen, was die Haltbarkeit erhöht.
So erkennen Sie Keramik aus Kaolin
1. Farbe und Weißgrad
Kaolin ist für seine strahlend weiße Farbe nach dem Brennen bekannt. Aufgrund des geringen Eisengehalts ist Keramik aus Kaolin typischerweise sehr weiß und von hoher Reinheit. Achten Sie bei der Untersuchung eines Keramikstücks auf einen gleichmäßigen, strahlend weißen Farbton. Weist das Stück eine gedämpftere oder ungleichmäßigere Farbe auf, besteht es möglicherweise nicht aus Kaolin.
2. Transluzenz
Hochwertige Kaolinkeramik weist oft eine gewisse Lichtdurchlässigkeit auf, insbesondere wenn sie gegen Licht gehalten wird. Diese Eigenschaft ist besonders bei dünneren Stücken wie Porzellan erkennbar. Wenn die Keramik Licht durchlässt, besteht sie wahrscheinlich aus Kaolin.
3. Glatte Textur
Kaolinkeramik hat aufgrund der Partikelgröße des Tons eine glatte, feine Textur. Streichen Sie mit den Fingern über die Oberfläche. Fühlt sie sich seidig und fein an, besteht sie möglicherweise aus Kaolin. Keramik aus gröberen Tonen kann sich dagegen körnig oder rau anfühlen.
4. Gewicht und Dichte
Kaolinkeramik ist tendenziell leichter als Keramik aus dichteren Tonen, fühlt sich aber dennoch robust an. Nehmen Sie das Stück in die Hand und schätzen Sie sein Gewicht. Ein gut geformtes Kaolinprodukt fühlt sich solide an, ohne übermäßig schwer zu sein.
5. Tonqualität
Klopfen Sie leicht mit Ihrem Fingernagel oder einem anderen harten Gegenstand auf die Keramik. Hochwertige Kaolinkeramik erzeugt einen klaren, resonanten Klang. Ist der Klang dumpf oder gedämpft, kann dies auf ein minderwertiges Material hinweisen.
6. Mangelfreiheit
Untersuchen Sie die Keramik auf Risse, Blasen oder Unebenheiten. Die feinen Eigenschaften von Kaolin ermöglichen bei richtiger Verarbeitung eine glattere Oberfläche und weniger Defekte. Eine gut verarbeitete Kaolinkeramik hat in der Regel ein makelloses Aussehen.
7. Querschnittsvergleich
Die Untersuchung des Querschnitts des Keramikkörpers kann zusätzliche Erkenntnisse liefern. Kaolinkeramik weist im Vergleich zu Keramik aus anderen Tonen typischerweise eine feinere und kompaktere Textur auf. Diese feine und dichte Struktur trägt zur Gesamtqualität und Ästhetik der Keramik bei.


Kaolin wird heute seit über 800 Jahren verwendet und wurde weltweit in verschiedenen Ländern entdeckt, darunter in den USA, Großbritannien und Brasilien. Die Rohstoffe für Keramik entwickelten sich von einer einkomponentigen Porzellansteinformel zu einer binären Formel, die mit der Kombination von Kaolin und Porzellanstein einen revolutionären Durchbruch erreichte. Kaolin ist jedoch auch heute noch das bevorzugte Material für hochwertige Keramik und wird von Keramikprofis, -liebhabern und -konsumenten gleichermaßen geschätzt.
Die Cheralle Keramik-Kaffeetasse stammt aus Jingdezhen, der Welthauptstadt des Porzellans. Dank ihrer geografischen Lage wird sie aus feinstem Kaolin gefertigt, um exquisite handgemachte Kaffeetassen zu kreieren. Bei einer hohen Temperatur von 1320 °C gebrannt, sind diese Tassen gesund, sicher und bieten täglich ein außergewöhnliches Kaffeeerlebnis.

CHERALLE
https://www.cheralle.comCheralle is a modern handcrafted ceramic drinkware brand dedicated to celebrating the artistry of everyday rituals. Every cup tells a story—from the clay’s origin to the final firing. Our signature handmade mugs are crafted through a meticulous 16-step process that ensures uniqueness, durability, and timeless elegance. Cheralle is more than a mug—it's your daily dose of calm and character.